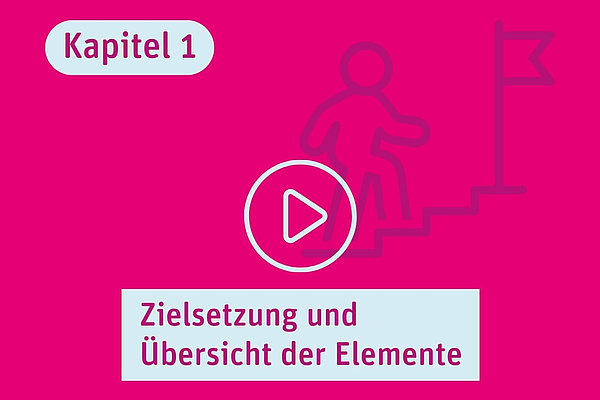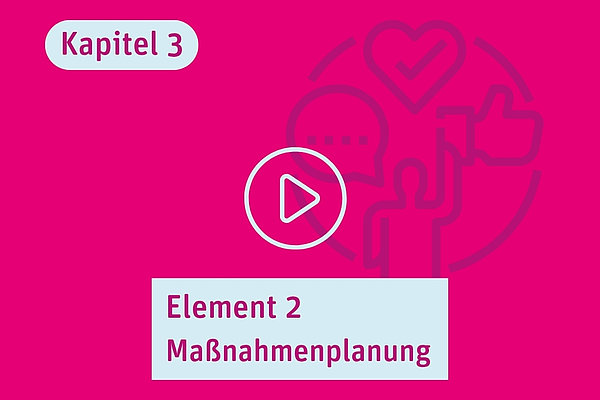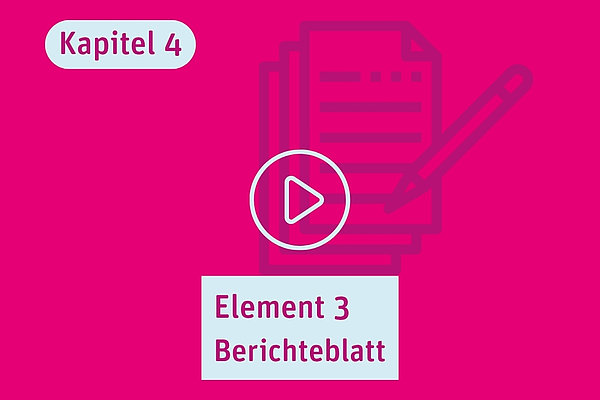Kooperationsbündnis Pflege Sachsen-Anhalt
Tragfähige und zukunftsorientierte Lösungen für qualitativ hochwertige Pflege
... wollen die Vertreterinnen und Vertreter im Kooperationsbündnis Pflege Sachsen-Anhalt unter der Leitung des Medizinischen Dienstes Sachsen-Anhalt voranbringen. Gemeinsam soll die pflegerische Versorgung gestärkt, Pflegequalität sichergestellt, fachlicher Austausch kontinuierlich ermöglicht und den Pflegemitarbeitenden der Rücken gestärkt werden.
Eine effiziente Gestaltung von Abläufen und der gezielte Einsatz von Mitteln/Methoden sind maßgeblich, um eine bedürfnis- und bedarfsgerechten Versorgung sicherzustellen und die Belastungen des Pflegepersonals zu minimieren.
Potenziale der Pflegedokumentation
Die Anforderungen an die Dokumentation nehmen mitunter viel Zeit in Anspruch, welche somit bei den zu versorgenden Personen fehlt. Hier setzt das Strukturmodell an – ein praxiserprobtes System zur Darstellung des Pflegeprozesses, das den Fokus wieder auf das Wesentliche legt: die individuelle und bedarfsgerechte Versorgung sowie die Fachlichkeit der Mitarbeitenden.
Die Methode fördert eine strukturierte und verständliche Erfassung der Pflegebedarfe, verbessert die Kommunikation innerhalb des Teams und sorgt dafür, dass die Ressourcen gezielt dort eingesetzt werden, wo sie am dringendsten benötigt werden.
Mit dem Blick darauf, die Pflege effizienter zu gestalten und dabei die Bedürfnisse Ihrer Klientinnen und Klienten bestmöglich zu berücksichtigen, möchten wir Sie ermutigen und unterstützen, das Strukturmodell aktiv in Ihren Arbeitsalltag zu integrieren. Lassen Sie uns gemeinsam die Entbürokratisierung in der Pflege voranbringen.
Entdecken Sie auf unserer Seite die Grundlagen und Vorteile des Modells und wie dessen Implementierung gelingen kann.
Geben Sie uns gerne eine Rückmeldung dazu oder lassen Sie uns an Ihren Ideen teilhaben.
Auch zu anderen Themen ist ein Austausch jederzeit möglich.
Das Kooperationsbündnis Pflege wird sich in jedem Jahr einem anderen Schwerpunkt in der Pflege widmen.
Faktencheck Pflegedokumentation
Stimmt doch, oder?
Dokumentation kann vernachlässigt werden, solange die Pflege gut ist.
Fakt ist:
Eine lückenhafte Dokumentation kann zu Missverständnissen, Fehlern und rechtlichen Problemen führen. Sie ist wichtig, um die erbrachten Leistungen nachzuvollziehen.
Auch wenn die Pflege qualitativ hochwertig ist, bleibt eine sorgfältige Dokumentation essenziell. Die Pflegedokumentation stellt sicher, dass alle am Versorgungsprozess Beteiligten über den aktuellen Zustand, Bedürfnisse, Bedarfe und Wünsche der zu Versorgenden informiert sind.
Sie dient nicht nur der Nachvollziehbarkeit und Qualitätssicherung, sondern ist auch aus rechtlicher Sicht unerlässlich. Die Dokumentation ist der Nachweis dafür, dass die erforderlichen Pflegemaßnahmen erfolgen. Im Falle von Beschwerden oder Haftungsfragen kann eine lückenhafte Dokumentation zu erheblichen rechtlichen Problemen führen.
Empfehlungen für die Praxis:
Erarbeiten Sie für alle Pflegebedürftigen eine individuelle und bedarfsgerechte Pflegedokumentation. Diese hilft, Veränderungen im Gesundheitszustand frühzeitig zu erkennen und darauf zu reagieren. Das Strukturmodell setzt genau hier an: es ermöglicht eine effiziente und praxisnahe Dokumentation, die den bürokratischen Aufwand reduziert, aber gleichzeitig alle wichtigen Informationen enthält. So bleibt mehr Zeit für die Pflege, ohne auf eine rechtssichere Dokumentation zu verzichten.
Fazit:
Die Dokumentation ist keine Option – sie ist ein wichtiger Bestandteil professioneller Pflege.
Alles, was man tut, muss dokumentiert werden.
Fakt ist:
Es ist wichtig, relevante und wesentliche Informationen zu dokumentieren, nicht jede kleine Handlung.
Häufig werden in der Pflegedokumentation Informationen oder Arbeitsschritte mehrfach und/oder zu ausführlich dokumentiert, um sich abzusichern. Darum geht es jedoch nicht. Ihr Zweck besteht darin, das Wesentliche festzuhalten sowie Veränderungen von Zustand oder Befinden der versorgten Person nachvollziehbar darzustellen und individuelle Bedürfnisse und Wünsche des Betroffenen zu berücksichtigen.
Empfehlungen für die Praxis:
Wichtige Hinweise finden Sie auf der Seite des Projektbüros EinSTEP:
www.ein-step.de [zum Öffnen der Seite hier klicken].
Die Auseinandersetzung hiermit zeigt beispielsweise, dass die Dokumentation von pflegerischen Routinemaßnahmen (z. B. Wechsel des Waschwassers) oder Selbstverständlichkeiten (z. B. Auftragen der Zahnpasta auf die Zahnbürste) keine Notwendigkeit ist.
Fazit:
Mehr Dokumentation ist keine bessere Absicherung.
Pflegedokumentation ist nur für die Nachweisführung gegenüber Vorgesetzten oder Behörden.
Fakt ist:
Generell dient die Pflegedokumentation zur professionellen bedarfsgerechten Planung, Durchführung und Überprüfung der Pflege.
Die versorgte Person ist dabei durch die konsequente Orientierung an den Bedürfnissen und Bedarfen stets Ausgangspunkt des pflegerischen Handelns. Die Pflicht zur Dokumentation ergibt sich aus diversen gesetzlichen Grundlagen. Darüber hinaus dient die Pflegedokumentation auch der internen Kommunikation im Team.
Empfehlungen für die Praxis:
Die Dokumentation sollte klar, nachvollziehbar und verständlich für alle am Prozess Beteiligten formuliert sein.
Zudem gilt es, im internen Qualitätsmanagement der jeweiligen Einrichtungen festzulegen, in welcher Art und Umfang die einrichtungsbezogene Pflegedokumentation erfolgt.
Fazit:
Stellen Sie Ihre Fachlichkeit bei der Dokumentation in den Mittelpunkt und vertrauen Sie auf Ihre Professionalität.
Ernährungs- und Trinkprotokolle müssen für alle versorgten Personen routinemäßig geführt werden.
Fakt ist:
Ernährungs- und Flüssigkeitsprotokolle sind nur im konkreten Einzelfall bei bestehendem Risiko oder ggf. vorliegender ärztlicher Anordnung und niemals für alle versorgten Personen einer Einrichtung zu führen.
Gemäß des Expertenstandards „Ernährungsmanagement zur Sicherung und Förderung der oralen Ernährung in der Pflege“ sind diese vorrangig im Rahmen des differenzierten Risikoassessments temporär (maximal 3 bis 5 Tage) zur Ursachenforschung erforderlich.
Empfehlungen für die Praxis:
Grundsätzlich ist immer die individuelle Situation der versorgten Person zu betrachten. Die pflegefachliche Einschätzung zur Ernährungs- und Flüssigkeitssituation ist dabei maßgeblich. Beim Einsatz von Ernährungs- und Flüssigkeitsprotokollen ist darauf zu achten, dass die tatsächlichen Trink- bzw. Essmengen über den ganzen Tag hinweg konsequent erfasst, ausgewertet und daraus ggf. notwendige pflegerische Maßnahmen nachvollziehbar abgeleitet werden.
Fazit:
Sie selbst mit Ihrer pflegefachlichen Einschätzung entscheiden über den Einsatz solcher Protokolle.
Digitale Dokumentation ist komplizierter als die manuelle.
Fakt ist:
Obgleich die Einführung zunächst mit Kosten und Aufwand verbunden sein kann, lohnt sich diese langfristig durch Effizienzgewinne.
Die Vorteile der Einführung sind u. a. Zeitersparnis (automatisierte Prozesse reduzieren den Schreibaufwand), bessere Lesbarkeit, schneller Zugriff von allen dafür vorgesehenen computergestützten Systemen und Datensicherheit (Papier kann verloren gehen).
Empfehlungen für die Praxis:
Entscheidend ist, dass alle am Versorgungsprozess Beteiligten einbezogen, geschult und mit der Software vertraut gemacht werden. Drüber hinaus muss das interne Qualitätsmanagement Zugriffsrechte regeln und Schutzmaßnahmen vor Cyberangriffen implementieren. Zudem ist eindeutig zu definieren, wie die Dokumentation bei Stromausfällen auszusehen hat.
Fazit:
Wie viele Vorteile die digitale Dokumentation gegenüber der manuellen ermöglicht, hängt von unterschiedlichsten Faktoren ab. Besonders wichtig sind: die Auswahl des Systems entsprechend den Ansprüchen, die richtige Implementierung, welche das Erreichen aller Mitarbeitenden sicherstellt, sowie die konsequente Begleitung bzw. das Gegensteuern bei Problemen. Erfahrungen haben die Vorteile einer digitalen Dokumentation bestätigt. Es kommt jedoch auch darauf an, wie gut sie in den Pflegealltag integriert wird.